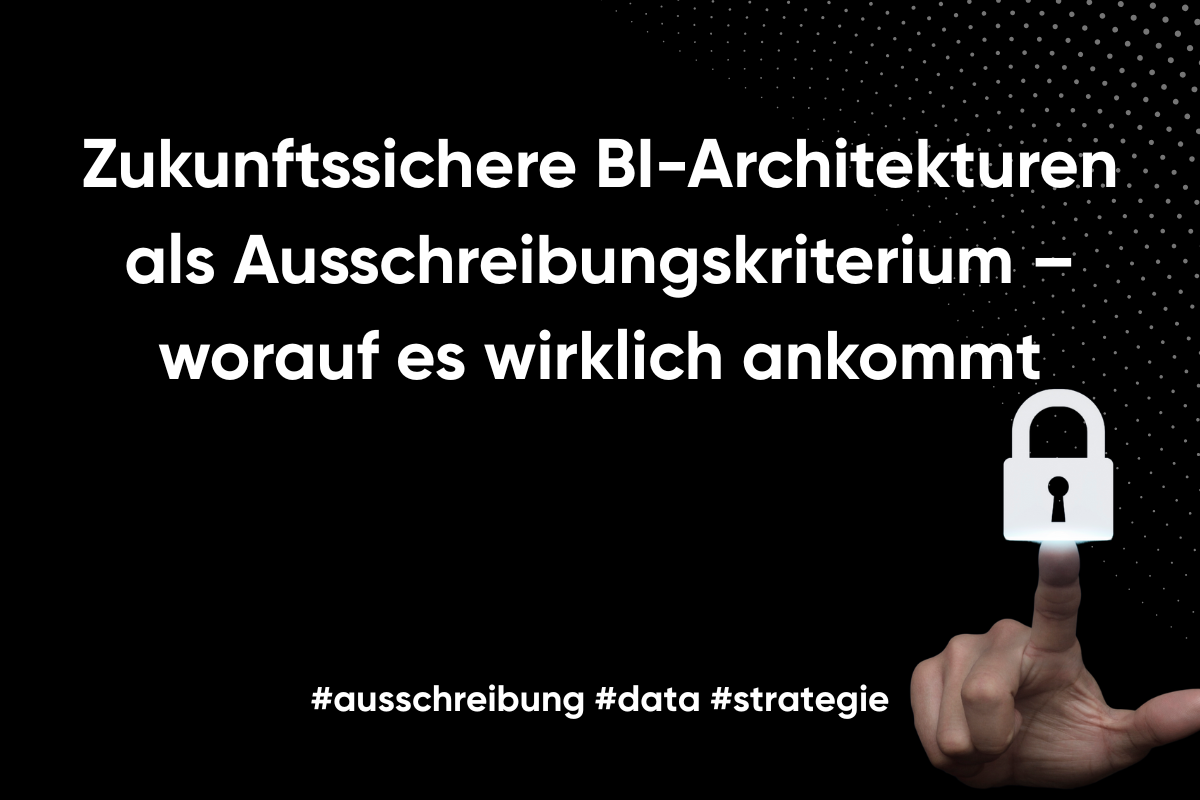Wer heute eine Business-Intelligence-Lösung plant, entscheidet nicht nur über ein Reporting-Tool, sondern über die technologische Basis der kommenden Jahre. Gerade bei Ausschreibungen für Datenplattformen und BI-Systeme ist die Architektur ein zentrales Kriterium – aber selten klar beschrieben. Begriffe wie Microsoft Power BI, Microsoft Fabric, Azure oder Databricks tauchen auf, ohne dass die strategischen und technischen Unterschiede transparent gemacht werden. In diesem Beitrag zeigen wir, worauf es bei zukunftssicheren BI-Architekturen wirklich ankommt – und was in einem Request for Proposal (RfP) keinesfalls fehlen darf.
Architektur entscheidet über Skalierbarkeit und Zukunftsfähigkeit
Eine BI-Architektur ist mehr als ein Systemdiagramm. Sie definiert, wie flexibel, sicher und performant ein Unternehmen mit Daten arbeiten kann – heute und morgen. Besonders in Regionen wie Baden, Zürich oder generell in der Deutschschweiz, wo Unternehmen zunehmend datengetrieben arbeiten, ist ein tragfähiges Fundament entscheidend. Cloud vs. On-Premises, zentral vs. dezentral, klassisches DWH vs. Lakehouse – wer diese Fragen nicht bewusst im RfP adressiert, riskiert technische Sackgassen oder kostspielige Umbauten in wenigen Jahren.
Cloud, Hybrid oder On-Premises – was passt zur Strategie?
Ein moderner RfP sollte die grundsätzliche Cloud-Strategie reflektieren. Viele Unternehmen setzen mittlerweile auf Azure, teils kombiniert mit bestehenden On-Premises-Systemen (Hybrid-Szenarien). Entscheidend ist, ob die geplante BI-Lösung diese Realität unterstützt: etwa durch native Azure-Dienste, verschlüsselte Datenflüsse, rollenbasierte Zugriffskonzepte und flexible Skalierbarkeit. Microsoft Fabric ist hier ein typisches Beispiel für eine SaaS-basierte Architektur mit integriertem Datenflussmanagement, während Azure-native Lösungen mehr Flexibilität bei der Individualisierung bieten.
Lakehouse oder klassisches DWH?
Während das klassische Data Warehouse auf strukturierte, stabile Datenmodelle setzt, erlaubt der Lakehouse-Ansatz – wie er z. B. bei Databricks zum Einsatz kommt – eine Kombination aus strukturierten und semi-strukturierten Daten mit hoher Flexibilität. Gerade wenn Machine Learning, Streaming-Daten oder Data Science Use Cases Teil der Zukunft sind, sollte das RfP die Option für ein Lakehouse explizit berücksichtigen. Gleichzeitig muss geprüft werden, ob ein reines DWH-Modell die bestehende BI-Landschaft (z. B. Power BI als Frontend) effizient genug unterstützt.
Self-Service: Nur mit Governance tragfähig
Viele Organisationen wollen Self-Service BI ermöglichen – meist mit Power BI. Doch ohne eine klar geregelte Architektur mit rollenbasiertem Zugriff, zertifizierten Datenquellen und sauberer Governance wird daraus schnell Chaos. In der Ausschreibung sollte daher definiert sein, wie Self-Service umgesetzt und kontrolliert wird. Wer darf Datenmodelle erstellen? Wie werden Workspaces strukturiert? Gibt es ein Center of Excellence oder definierte Entwicklungsrichtlinien?
Integrationsfähigkeit als Muss-Kriterium
Eine gute BI-Architektur steht nicht für sich allein. Sie muss sich nahtlos in bestehende Systeme einfügen: ERP, CRM, Data Lakes, Fileserver, externe APIs. Das RfP sollte also nicht nur die Zielarchitektur beschreiben, sondern auch die zu integrierenden Quellsysteme, etwa SAP, Dynamics 365 oder Web-APIs. Moderne Architekturen bieten hier Konnektoren, automatische Metadatenverarbeitung und Data Lineage – insbesondere Microsoft Fabric und Databricks unterstützen solche Anforderungen out-of-the-box.
Was im RfP konkret stehen sollte
Ein zukunftssicheres RfP sollte unter anderem folgende Punkte enthalten:
- Angabe der gewünschten Zielarchitektur (Cloud, Hybrid, On-Premises)
- Bevorzugtes Architekturmodell (klassisches DWH, Lakehouse, Kombination)
- Anforderungen an Skalierbarkeit, Performance und Betrieb
- Governance-Regelungen für Self-Service und Datenmanagement
- Integrationsanforderungen zu Quellsystemen und externen Diensten
- Langfristige Erweiterbarkeit (z. B. Einbindung von AI, Echtzeitdaten)
Fazit: Architektur ist mehr als Technik – sie ist strategische Grundlage
Eine BI-Ausschreibung ohne klare Architekturvorgaben ist wie ein Bauplan ohne Statik. Wer Technologien bewertet, ohne ihre Architekturkonsequenzen zu verstehen, entscheidet im Blindflug. Gerade in der Schweiz – zwischen pragmatischer Skalierbarkeit und hohen Datenschutzanforderungen – braucht es Lösungen, die flexibel, sicher und integrierbar sind. Ein gutes RfP schafft hier die Basis. Und eine gute Architektur sichert den Erfolg – nicht nur heute, sondern langfristig. Weitere Informationen zu unserer Begleitung von Ausschreibungen finden Sie hier.
Jetzt Kontakt aufnehmen
Suchen Sie Unterstützung bei der Definition Ihrer Zielarchitektur oder der Erstellung eines fundierten RfPs? Data Minds Consulting aus Baden begleitet Organisationen in der gesamten Deutschschweiz – strategisch, technologisch und unabhängig. Vereinbaren Sie jetzt ein unverbindliches Gespräch: